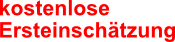Wann darf der Vermieter nach Modernisierung die Miete erhöhen?

Der Fall aus Bremen
Familie M. mietete von Juli 2011 bis August 2019 eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bremen. Im März 2017 kündigte die Vermieterin eine umfassende Modernisierung der Heizungsanlage an. Die alte Ausstattung mit einzelnen Kombithermen in jeder Wohnung sollte durch eine moderne Gaszentralheizung mit zentraler Warmwasseraufbereitung ersetzt werden.
Nach Abschluss der Arbeiten im Oktober 2017 erhöhte die Vermieterin die monatliche Grundmiete von 487 Euro um 59 Euro auf 546 Euro. Die Mieter zahlten diesen Erhöhungsbetrag bis zum Ende des Mietverhältnisses, forderten jedoch später 1.180 Euro als zu viel gezahlte Miete zurück.
Zentrale Streitfrage vor Gericht
Die entscheidende Frage lautete: Wie muss nachgewiesen werden, dass durch eine energetische Modernisierung tatsächlich Endenergie nachhaltig eingespart wird?
Das Berufungsgericht Bremen hatte eine strenge Auffassung vertreten. Die Richter verlangten, dass der tatsächliche Energieverbrauch über einen Zeitraum von vier bis fünf Jahren vor und nach der Modernisierung verglichen werden müsse. Da solche Verbrauchsdaten aus der Zeit vor der Modernisierung nicht vorlagen - die Mieter hatten zuvor eigene Energieverträge abgeschlossen - gaben die Bremer Richter den Mietern recht.
BGH korrigiert die Rechtsprechung
Der Bundesgerichtshof sah dies völlig anders und hob das Urteil auf. Die höchstrichterliche Entscheidung stellt klar: Vermieter können eine Mieterhöhung nach energetischer Modernisierung bereits dann verlangen, wenn zum Zeitpunkt der Mieterhöhungserklärung eine messbare und dauerhafte Einsparung von Endenergie zu erwarten ist.
Was bedeutet "Endenergie"? Unter Endenergie versteht man die Menge an Energie, die der Anlagentechnik eines Gebäudes zur Verfügung stehen muss. Dazu gehören Heizung, Warmwasseraufbereitung und Lüftung. Diese Energie wird an der Gebäudehülle gemessen und in Form von Heizöl, Erdgas, Strom oder Fernwärme bereitgestellt.
Prognostische Berechnung statt Langzeitmessung
Der BGH betont, dass eine nachhaltige Endenergieeinsparung nicht durch langjährige Verbrauchsmessungen belegt werden muss. Stattdessen reichen prognostische Berechnungen aus. Vermieter können dabei auf anerkannte Pauschalwerte zurückgreifen, wie sie etwa in der Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohngebäudebestand festgelegt sind.
Dies ergibt sich aus mehreren praktischen Überlegungen: Der tatsächliche Energieverbrauch wird von vielen Faktoren beeinflusst, die nichts mit der Modernisierungsmaßnahme zu tun haben. Dazu gehören Wetter, Leerstand von Wohnungen, Anzahl der Bewohner und deren individuelles Heizverhalten. Ein Vergleich der realen Verbrauchswerte würde daher kein zuverlässiges Bild über die Wirksamkeit der baulichen Maßnahme liefern.
Beweislast liegt beim Mieter
Ein weiterer wichtiger Punkt der Entscheidung betrifft die Beweislast. Wenn Mieter die Rückzahlung von Mieterhöhungsbeträgen fordern, müssen sie beweisen, dass die Voraussetzungen für die Mieterhöhung nicht erfüllt waren. Dies entspricht den allgemeinen Regeln im Bereicherungsrecht.
Das Berufungsgericht hatte fälschlicherweise angenommen, dass die Vermieterin die Darlegungs- und Beweislast für die Wirksamkeit ihrer Modernisierungsmaßnahme trägt. Der BGH stellte klar, dass dies nur bei der ursprünglichen Geltendmachung der Mieterhöhung der Fall ist, nicht aber bei späteren Rückforderungsklagen der Mieter.
Formelle Anforderungen bleiben bestehen
Der BGH bestätigte gleichzeitig, dass das Mieterhöhungsverlangen der Vermieterin den formellen Anforderungen entsprochen hatte. Vermieter müssen energetische Modernisierungen ordnungsgemäß ankündigen und die Mieterhöhung korrekt begründen. Eine Aufschlüsselung der Gesamtkosten nach einzelnen Gewerken ist dabei nicht erforderlich.
Rechtlicher Hintergrund zur energetischen Modernisierung
Energetische Modernisierung liegt vor, wenn durch bauliche Veränderungen in Bezug auf die Mietsache Endenergie nachhaltig eingespart wird. Der Begriff der baulichen Veränderungen ist dabei weit auszulegen. Er umfasst nicht nur Eingriffe in die Bausubstanz, sondern auch Veränderungen der Anlagentechnik wie den hier erfolgten Austausch der Heizungsanlage.
Nach geltendem Recht können Vermieter elf Prozent der für energetische Modernisierungen aufgewendeten Kosten jährlich auf die Miete umlegen. Diese Regelung soll Anreize für klimafreundliche Investitionen in den Gebäudebestand schaffen.
Was bedeutet das Urteil für Sie?
Für Vermieter: Die Entscheidung erleichtert energetische Modernisierungen erheblich. Sie müssen nicht mehr jahre- oder jahrzehntelang warten, um den Nachweis der Energieeinsparung durch tatsächliche Verbrauchsmessungen zu führen. Stattdessen können sie sich auf fachlich anerkannte Berechnungsgrundlagen und Pauschalwerte stützen.
Dies schafft Rechtssicherheit bereits bei der Planung von Modernisierungsmaßnahmen. Vermieter können besser kalkulieren, ob sich energetische Investitionen durch spätere Mieterhöhungen refinanzieren lassen. Wichtig bleibt: Die Modernisierungsankündigung und die Mieterhöhungserklärung müssen allen formellen Anforderungen entsprechen.
Für Mieter: Das Urteil macht es schwieriger, Mieterhöhungen nach energetischen Modernisierungen erfolgreich anzugreifen. Mieter können nicht mehr darauf vertrauen, dass fehlende Verbrauchsdaten automatisch gegen die Vermieterin sprechen. Wer die Rückzahlung von Modernisierungsumlage fordert, trägt die Beweislast dafür, dass die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt waren.
Mieter sollten daher: Bei Modernisierungsankündigungen genau prüfen, ob alle formellen Anforderungen eingehalten wurden. Zweifelhaft erscheinende Fälle sollten frühzeitig mit einem Fachanwalt besprochen werden, da spätere Rückforderungen schwieriger durchsetzbar sind.
Klimaschutz und Interessenausgleich
Der BGH betont in seiner Entscheidung den vom Gesetzgeber angestrebten Interessenausgleich. Einerseits sollen Mieter vor überzogenen Mieterhöhungen geschützt werden. Andererseits müssen für Vermieter angemessene Bedingungen für die wirtschaftliche Verwertung ihres Eigentums bestehen.
Die Entscheidung stärkt die klimapolitischen Ziele: Energetische Gebäudesanierung wird gefördert, indem bürokratische Hürden abgebaut werden. Gleichzeitig bleibt der Schutz der Mieter durch die formellen Anforderungen und die Begrenzung der umlagefähigen Kosten gewährleistet.
Das Urteil zeigt beispielhaft, wie das Recht auf veränderte gesellschaftliche Anforderungen reagiert. In Zeiten des Klimawandels gewinnen energetische Modernisierungen an Bedeutung. Das Mietrecht muss dieser Entwicklung Rechnung tragen, ohne den sozialen Wohnungsschutz aufzugeben.
Quelle: BGH, Urteil vom 26. März 2025 - VIII ZR 283/23
Kontaktieren Sie uns!
Die Informationen auf unserer Website dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie ersetzen keine rechtliche Beratung, die auf Ihre individuelle Situation zugeschnitten ist. Bitte beachten Sie auch, dass sich die Rechtslage durch neue Gesetze und Urteile jederzeit ändern kann.
Für detaillierte Fragen oder eine individuelle Beratung stehen Ihnen die Experten unserer Kanzlei für Mietrecht in Essen zur Verfügung. Wir helfen Ihnen, die beste Strategie für Ihr spezifisches Anliegen zu entwickeln.
Wir sind echte Experten im Mietrecht.

Sie sind ratlos im Streit mit Ihrem Mieter oder Vermieter? Sie stehen vor komplexen Vertragsverhandlungen oder es geht um den Erwerb, Veräußerung oder Vererbung von Immobilieneigentum. Wir haben uns auf das private und gewerbliche Mietrecht, Immobilienrecht und Maklerrecht spezialisiert. Vertrauen Sie uns. Zögern Sie also nicht länger und holen Sie sich die Unterstützung, die ein professionelles Vorgehen ermöglicht. Lassen Sie uns gemeinsam eine Strategie für die Umsetzung Ihres Vorhabens besprechen.
Unsere digitale Kanzlei

Bei uns geht Recht vollkommen digital. Für Sie entscheidend: Sie können alles bequem von überall aus organisieren. Besuchen Sie unsere Webseite und buchen Sie ein Video-Meeting mit einem Anwalt. Ihre Unterlagen können Sie einfach uploaden. Selbst erforderliche Unterschriften können Sie bei uns digital leisten.
kostenlose Ersteinschätzung

Lassen Sie uns bei einem unverbindlichen Kennenlerngespräch über Ihre spezifischen rechtlichen Anliegen sprechen.
Das könnte Sie auch interessieren:
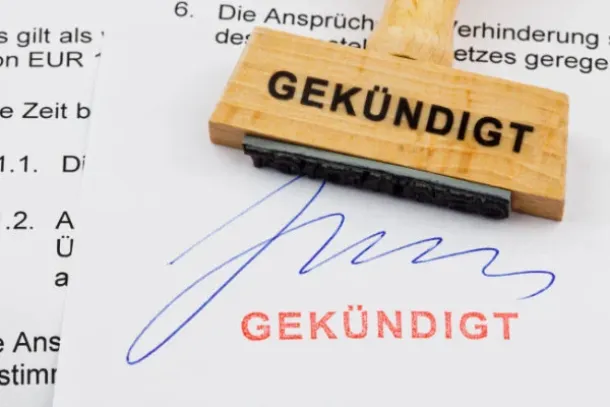
Wohnungsmietvertrag kündigen – ein Leitfaden für Mieter und Vermieter

Ein Objekt - zwei Makler: Wer bekommt die Provision?
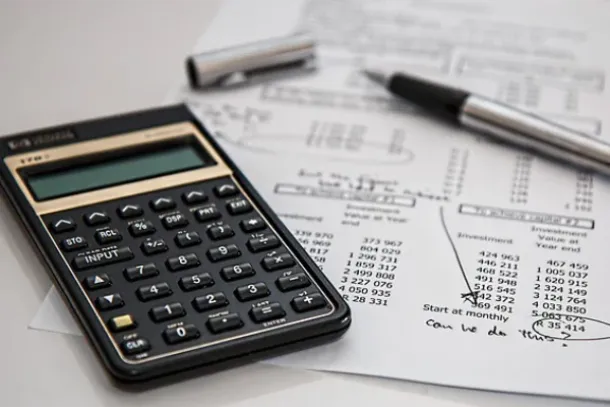
Verwalterwechsel: Wer muss fehlerhafte Jahresabrechnungen korrigieren?